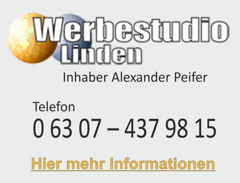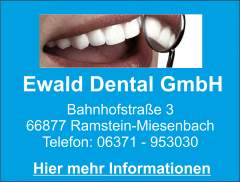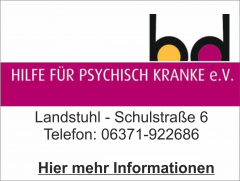-Kleine Naturexpedition für Familien in der Biosphärenakademie-
„Tiere im Garten entdecken und bestimmen“ heißt es am Mittwoch, 31. Juli, von 15 bis 17.30 Uhr in der Biosphärenakademie in Lambrecht. Gärten stellen im besten Fall nicht nur Erholungsräume für den Mensch dar, sondern bieten darüberhinaus vielfältige Lebensräume für heimische Tierarten. Diese Artenvielfalt bildet den Schwerpunkt der kleinen Naturexpedition in den sommerlichen Garten, bei der die Teilnehmenden unter anderem erfahren, welche Tiere aktuell in den Gärten zu Hause sind und wie man sie erkennen kann. Darüber hinaus gibt es jede Menge Tipps, wie ein Garten zum Paradies für Tiere werden kann.
Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene und Familien mit Kindern ab etwa sechs Jahren. Empfehlenswert sind feste Schuhe, wetterfeste Kleidung und Sonnenschutz. Die Kosten für die Teilnahme liegen bei vier Euro für Erwachsene und zwei Euro pro Kind. Treffpunkt ist der Haupteingang der Pfalzakademie, Franz-Hartmann-Straße 9, in Lambrecht. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist bis 29. Juli erforderlich bei Isabell Mansmann, Telefon 06325 9552-45, E-Mail: i.mansmann@pfaelzerwald.bv-pfalz.de. Infos zur Bisophärenakademie gibt Ulrich Diehl, Telefon 06325 9552-44, E-Mail: u.diehl@pfaelzerwald.bv-pfalz-de.
Zur Sache: Das Biosphärenreservat Pfälzerwald und seine neue Biosphärenakademie
Seit dem Frühjahr 2024 ist das Biosphärenreservat Pfälzerwald um einen attraktiven Baustein reicher. Eine Kräuterbar, eine Holzwerkstatt und eine Wasserwerkstatt laden unter dem Namen „Biosphärenakademie“ zum Tüfteln, Lernen und Erleben ein.
Die Akademie des Biosphärenreservats Pfälzerwald hat das Ziel, den Biosphären-Leitgedanken „Mensch und Biosphäre“ für die Menschen in der Region und darüber hinaus erfahr- und erlebbar zu machen. Mit einem breit gefächerten Angebot an Bildungs-, Genuss- und Erlebnisveranstaltungen eröffnet die Biosphärenakademie vielfältige Möglichkeiten, das Biosphärenreservat, seine Grundlagen und seine Besonderheiten zu entdecken und zu verstehen.
Die Vielfalt bezieht sich dabei sowohl auf die Themen, die im Rahmen der Biosphärenakademie präsentiert werden, als auch auf die Veranstaltungsformate: Exkursionen und Führungen, handwerkliche Kurse, Themen- und Erlebnistage, Vorträge und Schulklassenveranstaltungen stehen auf dem Programm. Angesprochen sind Kinder und Familien, Erwachsenengruppen, Schulklassen sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Die Veranstaltungsangebote werden gemeinsam mit einem Netzwerk von Partnerinnen und Partnern aus dem Biosphärenreservat umgesetzt und finden das gesamte Jahr über statt.
(Foto: Biosphärenreservat/Ulrich Diehl)